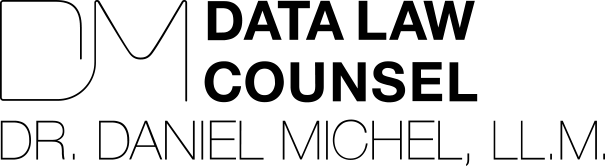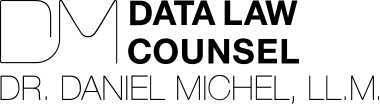Urteil vom 11.11.2025 – 42 O 14139/24 (nrkr)
Das Landgericht München I hat mit Urteil vom 11. November 2025 den von der Verwertungsgesellschaft GEMA geltend gemachten Ansprüchen gegen zwei Unternehmen der Open-AI-Gruppe im Wesentlichen stattgegeben. Die Entscheidung markiert einen europaweit beachteten Meilenstein für den urheberrechtlichen Umgang mit großen KI-Modellen (Large Language Models, LLMs) und dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Trainingspraxis der KI-Industrie haben.
Kern des Rechtsstreits
Die GEMA hatte festgestellt, dass Liedtexte mehrerer deutscher Urheber – u. a. „Atemlos“, „Über den Wolken“, „Bochum“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ – in Trainingsdaten von OpenAI enthalten waren. Die Texte ließen sich anschließend durch einfache Nutzerabfragen „weitgehend originalgetreu“ von ChatGPT abrufen. Die GEMA sah hierin unberechtigte Vervielfältigungen und eine öffentliche Zugänglichmachung der Werke.
OpenAI bestritt eine Speicherung konkreter Trainingsdaten und verwies darauf, dass Outputs nur aufgrund von Nutzerprompts generiert würden. Eventuelle Eingriffe seien zudem von den Schranken für Text- und Data-Mining (TDM) gedeckt.
Entscheidung des Gerichts
Das LG München I folgte diesen Argumenten nicht und stellte klar:
Memorisierung in KI-Modellen ist eine Vervielfältigung i. S. d. Art. 2 InfoSoc-RL und § 16 UrhG
Nach Überzeugung der 42. Zivilkammer sind die streitgegenständlichen Liedtexte reproduzierbar in den Modellen ChatGPT-4 und 4o enthalten. Die Memorisierung sei durch Abgleich von Trainingstexten und generierten Outputs belegt. Angesichts der Komplexität und Länge der Texte schied ein bloßer Zufall aus.
Damit liege eine verkörperte Festlegung der Werke in den Modellparametern vor. Die Richterin betonte, dass auch neue Technologien wie KI-Modelle vom Vervielfältigungsrecht erfasst seien. Bereits eine mittelbare Wahrnehmbarkeit über technische Hilfsmittel genüge.
Text- und Data-Mining-Schranken greifen nicht
Das Gericht erteilte einer weiten Auslegung der TDM-Schranken (§ 44b UrhG) eine klare Absage:
- Die Schranke erlaube nur vorbereitende Analysehandlungen ohne Werkrelevanz.
- Beim KI-Training von OpenAI seien jedoch nicht nur Informationen extrahiert, sondern die Werke selbst vervielfältigt worden.
- Dies stelle einen unmittelbaren Eingriff in die Verwertungsrechte dar.
- Eine analoge Anwendung der Schranke komme wegen fehlender vergleichbarer Interessenlage nicht in Betracht.
Die Entscheidung betont, dass eine Memorisierung urheberrechtlich relevant ist und nicht vergütungsfrei erfolgen darf.
Unberechtigte öffentliche Zugänglichmachung in den Outputs
Auch die Ausgabe der Texte durch ChatGPT sei eine urheberrechtsrelevante Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung.
Wichtig: Die Kammer sah OpenAI selbst – und nicht die Nutzer – als verantwortlich an. Nutzerprompts wie „Wie lautet der Text von ‚Bochum‘?“ seien nicht geeignet, den Eingriff dem Nutzer zuzuordnen.
Kein Schutz durch § 57 UrhG (unwesentliches Beiwerk)
Die Liedtexte seien nicht „beiwerkartig“, da ein „Hauptwerk“ im Sinne der Vorschrift fehle. Der gesamte Trainingsdatensatz sei kein urheberrechtlich geschütztes Werk.
Kein Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht
Nur einen Punkt wies das Gericht ab: Die GEMA konnte keine fehlerhaften Zuschreibungen oder verfälschten Liedtexte als Persönlichkeitsrechtsverletzung durchsetzen.
Deutlicher Hinweis der Vorsitzenden Richterin
Bemerkenswert ist die richterliche Klarstellung, dass Trainingsdaten in KI-Modellen grundsätzlich dauerhaft bleiben, sofern der gesamte Datensatz nicht gelöscht werde. Die beantragte Übergangsfrist für die Weiternutzung wurde daher abgelehnt.
Bewertung und Bedeutung für die Praxis
Das Urteil ist nicht rechtskräftig; OpenAI hat Berufung angekündigt. Gleichwohl handelt es sich um die erste umfangreiche europäische Entscheidung zur urheberrechtlichen Zulässigkeit des KI-Trainings mit geschützten Werken. Die Signalwirkung ist erheblich:
- KI-Unternehmen müssen damit rechnen, dass das Training mit urheberrechtlich geschützten Texten ohne Erlaubnis rechtswidrig ist.
- Die Entscheidung stärkt die Position von Verwertungsgesellschaften und Rechteinhabern in bevorstehenden Lizenzverhandlungen.
- Sie grenzt den Anwendungsbereich der TDM-Schranken deutlich ein – insbesondere im kommerziellen KI-Kontext.
- KI-Anbieter müssen künftig bei Trainingsprozessen Memorisierungsrisiken aktiv vermeiden oder anderweitige rechtssichere Lösungen (z. B. Lizenzierung, Filtermechanismen, Redaktionspflichten) entwickeln.
Ausblick
Ob und inwieweit höhere Instanzen die Entscheidung bestätigen, wird für den europäischen KI-Markt von strategischer Bedeutung sein. Angesichts paralleler Regulierungsbemühungen auf EU-Ebene – insbesondere durch den AI Act – dürfte der Druck auf KI-Anbieter, transparente und rechtssichere Trainingsprozesse einzuführen, weiter steigen.
Konkrete Handlungsanweisungen zum Umgang mit KI-Systemen nach dem Urteil des LG München I
Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln, trainieren oder integrieren, sollten folgende Punkte beachten:
Trainingsdaten auditieren
- Klären Sie, welche Datenquellen für Trainings-, Feintrainings- oder RAG-Prozesse genutzt werden.
- Vermeiden Sie den Einsatz von Texten oder sonstigen Werken, für die keine Rechte oder Lizenzen vorliegen.
- Dokumentieren Sie Datenherkunft und Rechtekette („Data Provenance“).
Memorisierungsrisiken aktiv managen
- Berücksichtigen Sie, dass Modelle geschützte Inhalte memorisieren und reproduzieren können.
- Setzen Sie auf technische Verfahren zum „De-Memorisieren“ oder zur Minimierung der Reproduzierbarkeit (Filter, RLHF-Ausblendungen, Retrieval-Ansätze).
Modelle nur mit rechtssicheren Datensätzen trainieren
- Bevorzugen Sie lizenzierte, gemeinfreie oder vertraglich geklärte Datenpools.
- Bei Open-Source-Modellen: Nutzungsbedingungen und mögliche urheberrechtliche Restriktionen prüfen.
KI-Outputs im Unternehmen kontrollieren
- Prüfen Sie, ob die eingesetzten Systeme geschützte Inhalte reproduzieren.
- Implementieren Sie interne Nutzungsrichtlinien („AI Usage Policies“), insbesondere für Marketing, Produkttexte und Kundenkommunikation.
Vertragsgestaltung anpassen
- In Entwicklungs-, Lizenz- oder Integrationsverträgen sollten klar geregelt sein:
- Datenrechte und -quellen,
- Haftungsverteilung bei Urheberrechtsverletzungen,
- Zusicherungen zur Memorisierungsprävention,
- Pflichten zur Löschung oder Erneuerung von Modellen bei Rechtsverstößen.
Risiken aus der KI-Regulierung (EU AI Act) einbeziehen
- KI-Anbieter müssen künftig detaillierte Dokumentationen, Transparenzangaben und Urheberrechts-Compliance sicherstellen.
- Verstöße können hohe Bußgelder auslösen – zusätzlich zu zivilrechtlichen Ansprüchen.